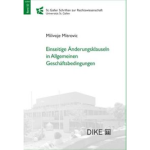Die «Risikoabwälzungsfunktion» der AGB ist bedenklich und ruft nach rechtlicher Kontrolle.
Missbrauchsgefahr
Die AGB-Ausarbeitung durch den AGB-Verwender bewirkt eine privatautonome, einseitige Gestaltungsmacht (= einseitige Normsetzung).
Es liegt in der «Logik» des Geschäftslebens, dass der AGB-Verwender seine Gestaltungsmacht nicht altruistisch einsetzt, sondern versucht, seine Interessen möglichst weitgehend zum Durchbruch zu verhelfen:
- «Risikoabwälzungsfunktion» der AGB
- zB Wegbedingung der Gewährleistungsansprüche für Mängel der Leistung;
- zB Haftung für Schäden aus Vertragsverletzung
- «Gewährleistungsklauseln»
- «Haftungsfreizeichnungsklauseln».
Literatur
- KRAMER ERNST A. / PROBST THOMAS / PERRIG ROMAN, Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 2. Auflage, Bern 2023, S. 5 ff.
- BAUDENBACHER CARL, Wirtschafts-, schuld- und verfassungsrechtliche Grundsatzprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zürich 1983, S. 174 ff.
- ATAMER YESIM M., Unlauterer Wettbewerb durch Nutzung von ungültigen AGB?, in: Emmenegger/Hrubesch-Millauer/Krauskopf/Wolf(Hrsg.), Brücken bauen. Festschrift Thomas Koller, Bern 2018, S. 38 ff.
Judikatur
- BGE 122 III 188 ff.
Weiterführende Informationen
Schutzbedürftigkeit des Kunden (AGB-Übernehmers)
Die Schutzbedürftigkeit des AGB-Übernehmers (Kunden) gegenüber dem seine Position einseitig ausnützenden AGB-Verwenders wird mit der sog. „Ungleichgewichtsthese“ begründet:
- Übermacht des AGB-Verwenders
- Schwäche des AGB-Übernehmers (Kunde).
Mitentscheidend ist die Art des AGB-Verwender (Kunde):
- Konsumentenvertrag bzw. Verbrauchervertrag,
- Unternehmen-Konsumenten-Geschäft (B2C),
- den der Kunde zu privaten Zwecken mit einem Unternehmer (in wirtschaftlicher Unterlegenheit) schliesst.
- Unternehmen-Konsumenten-Geschäft (B2C),
- Geschäftsvertrag
- Unternehmen-Unternehmens-Geschäft (B2B),
- den der Kunde als Unternehmen im Geschäftsverkehr zwischen einem Drittunternehmen (Produzent, Händler, Zulieferer etc.), ohne Anwendung des Konsumentenschutzrechts schliesst;
- Hier können sich die Fragen stellen:
- Übermacht (marktbeherrschende Stellung);
- Ausweichmöglichkeit zu Konkurrent («take it or leave it»-Situation)(vgl. MORIN, a.a.O., S. 522).
- Unternehmen-Unternehmens-Geschäft (B2B),
Literatur
- KRAMER ERNST A. / PROBST THOMAS / PERRIG ROMAN, Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 2. Auflage, Bern 2023, S. 7 ff.
- BAUDENBACHER CARL, Wirtschafts-, schuld- und verfassungsrechtliche Grundsatzprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zürich 1983, S. 318 ff.
- HEISS HELMUT, Kommentierung des Art. 8 UWG, in: Holzmann/Loacker (Hrsg.) UWG-Kommentar, Zürich / St. Gallen 2018 , Art. 8 UWG N 15 f.
- MORIN ARIANE, Les clauses contractuelles non négociées, ZSR 128 (2009) I, S. 522
Weiterführende Informationen
Ansatzpunkte einer AGB-Kontrolle
Die Missbrauchsgefahr des AGB-Verwenders und die Schutzbedürftigkeit des AGB-Übernehmers (Kunde) verlangen eine spezifische rechtliche Kontrolle:
Dafür kommen zwei alternative Kontrollmodelle in Frage:
- ex ante-Variante
- Modell einer präventiven, ex ante eingesetzten Verwaltungskontrolle der AGB;
- Vor einer Geschäftsverkehrverwendung müssen die AGB einer Verwaltungsbehörde zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden (vor 2004: VAG).
- Modell einer präventiven, ex ante eingesetzten Verwaltungskontrolle der AGB;
- Richterliche ex post-Variante
- Modell einer richterlichen ex-post-Kontrolle
- Dieses Modell hat Vorteile:
- Breitenwirkung der Kontrolle;
- Keine unerwünschte Verbürokratisierung des unternehmerischen Vertragsverkehrs;
- AGB-Übernehmer müssen sich gegen Einseitigkeit der AGB vor Gericht individuell wehren,
- OR 20
- (Geltendmachung der Nichtigkeit einzelner Klauseln)
- UWG 9
- (durch die im UWG vorgesehenen Klagemöglichkeiten);
- OR 20
- relativ geringe «Ahndungswahrscheinlichkeit“,
- Kundenindividualklagen
- (Im Obsiegensfalle Rechtskraft für das einzelne Vertragsverhältnis (vgl. UWG 10 Abs. 2)
- Verbandsklage
- (ns. Konsumentenschutzverbände);
- Klagemöglichkeit des Bundes
- (vgl. UWG 10 Abs. 3 UWG).
- Kundenindividualklagen
- Dieses Modell hat Vorteile:
- Modell einer richterlichen ex-post-Kontrolle
Literatur
- KRAMER ERNST A. / PROBST THOMAS / PERRIG ROMAN, Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 2. Auflage, Bern 2023, S. 15 ff.
- KRAMER ERNST A., Konzeptionsfragen zur Vertragsinhaltskontrolle, in: ZSR 137 (2018) I. S. 319 ff.
Weiterführende Informationen
Ansatzpunkte der richterlichen AGB-Kontrolle
Der Ansatz zur richterlichen Kontrolle von AGB‘s ist im Wesentlichen ein vierfacher:
- Konsenskontrolle (Einbeziehungskontrolle)
- Grundsatz
- Die AGB müssen dem Kunden vom AGB-Verwender vor Vertragsschluss in zumutbarer Weise zur Kenntnis gebracht worden sein.
- Maximen
- «Ungewöhnlichkeitsregel“
- Konsenskontrolle der sog. «battle of the forms»
- AGB-rechtliches „Transparenzgebot“
- Besonderer Kontrollaspekt an der Schnittstelle zwischen
- Konsenskontrolle;
- Interpretationskontrolle;
- Inhaltskontrolle
- Besonderer Kontrollaspekt an der Schnittstelle zwischen
- Grundsatz
- Auslegungskontrolle (Interpretationskontrolle)
- Grundsatz
- Die Konsenskontrolle bei AGB-Verträgen ist untrennbar verzahnt mit der AGB-Auslegungskontrolle (Interpretationskontrolle).
- Maximen
- AGB-Klauseln unterliegen als Vertragsbestandteile den allgemeinen, zu OR 18 entwickelten, auf den konkreten Vertragsschluss abstellenden vertragsrechtlichen Interpretationsregen;
- AGB-Formulierungen können auch Sonderregeln des Kundenschutzes folgen, wie
- Unklarheitenregeln
- interpretatio contra proferentem
- in dubio contra stipulatorem
- Vorrang der Individualabrede.
- Unklarheitenregeln
- Grundsatz
- allgemeine Gültigkeitskontrolle,
- Grundsatz
- Wenn beide Kontrahenten den AGB zugestimmt haben, muss schliesslich auch ihr Inhalt auf seine rechtliche Haltbarkeit überprüft werden.
- Maximen
- Die allgemeine Gültigkeitskontrolle ist eine Kontrolle nach den im schweizerischen Recht geltenden Regeln, wie
- OR 19
- OR 20 OR i.V.m. ZGB 27 Abs. 2.
- Die allgemeine Gültigkeitskontrolle ist eine Kontrolle nach den im schweizerischen Recht geltenden Regeln, wie
- Grundsatz
- verschärfte Inhaltskontrolle.
- Grundsatz
- Aufgrund von UWG 8 werden die AGB einer verschärften Inhaltskontrolle («Angemessenheitskontrolle»)
- Maxime
- Ein rechtlich tolerierbarer Inhalt kann trotz der obg. abgehandelten Schutzerwägungen sozusagen getoppt werden:
- Vertragsinhalte, welche individuell ausgehandelt wurden, können, wenn es sich um eine AGB-Klauseln handelt, nicht mehr als akzeptabel erachtet werden (sog. „Theorie der Ordnungsfunktion des dispositiven Rechts“).
- Vgl. hiezu KRAMER ERNST A. / PROBST THOMAS / PERRIG ROMAN, Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 2. Auflage, Bern 2023, S. 20 ff., N 22 ff.
- Ein rechtlich tolerierbarer Inhalt kann trotz der obg. abgehandelten Schutzerwägungen sozusagen getoppt werden:
- Grundsatz
Literatur
- KRAMER ERNST A. / PROBST THOMAS / PERRIG ROMAN, Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 2. Auflage, Bern 2023, S. 17 ff.
- KRAMER ERNST A., Konzeptionsfragen zur Vertragsinhaltskontrolle, in: ZSR 137 (2018) I. S. 319 ff.
Judikatur
- AGB-Klauseln als Vertragsbestandteile gemäss OR 18
- BGE 122 III 118 ff.
- BGE 133 III 675 ff.
Weiterführende Informationen
Das könnte Sie auch noch interessieren:
Vorbehalt / Disclaimer
Diese allgemeine Information erfolgt ohne jede Gewähr und ersetzt eine Individualberatung im konkreten Einzelfall nicht. Jede Handlung, die der Leser bzw. Nutzer aufgrund der vorstehenden allgemeinen Information vornimmt, geschieht von ihm ausschliesslich in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko.
Urheber- und Verlagsrechte
Alle in dieser Web-Information veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheide und Leitsätze, soweit sie von den Autoren oder den Redaktoren erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Web-Information darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – sämtliche technische und digitale Verfahren – reproduziert werden.